Startseite · Interview · Gefragt

Christian Ludwig Mayer
Ruf des Waldes
„Unstillbare Neugier auf die Musiktraditionen aller Zeiten und Länder“ treibt diesen Tausendsassa um.
Am Beginn seines musikalischen Kosmopolitismus stand eine Kindheit als Eigenbrötler, in der er einsam in den Wäldern des voralpinen Hinterlands herumstreunte. Dass er in einer Art kultureller Isolation weitgehend als Autodidakt zur Musik fand, hat den Allgäuer zum originellen, stilistische Barrieren überschreitenden Klaviervirtuosen, Multiinstrumentalisten und Komponisten gemacht. Da Mayer anfangs keine Noten lesen konnte, fand er fast zwangsläufig zu Improvisation und Jazz. Wie Jean Pauls vergnügtes Schulmeisterlein Maria Wutz, der sich aus Armut Bücher von Schiller und Kant selber schrieb, habe er sich seinen „Mozart selbst zusammengebastelt“. Und das Stride-Piano habe er, bevor er wusste, dass es existierte, für sich selbst erfunden, indem er den typischen Wechsel zwischen Bass-Note und Akkord vom in der ländlichen Musik verankerten Akkordeon auf das Klavier übertragen habe. Seinen Weg fernab des Mainstreams hatte er schon gefunden, als er relativ spät studierte. Vor allem seinem Cembalo-Unterricht bei Michael Eberth verdankt er eine zusätzliche tiefe Verankerung bei alten Meistern wie Froberger und Biber. Die Ästhetik der Überraschung durch Abweichung von der Erwartung vereint Frühbarock, Jazz und die Musik Mayers, die sich mit seltsamen stilistischen Wendungen in jede erdenkliche Richtung bewegen kann.
Der Wald, der ihm in der Kindheit ein zweites Zuhause war, verleiht seinem „Auwald Trio“, das eben das Album „Token Gestures“ vorgelegt hat, den Namen. Zugleich spiegelt er seine Liebe zu den Dichtern der Romantik, hat er doch einen ähnlichen literarischen Geschmack wie Robert Schumann; selbst im Gespräch über Bix Beiderbecke, Django Reinhardt oder Duke Ellington kann er auf E.T.A. Hoffmann oder Eichendorff verweisen.
Mit Lederhose in Singapur
Mayer, für den „das in der Gegenwart Fehlende über die Musik hereinzuholen“ Antrieb zum Komponieren ist, schreibt Werke, die in keine Schublade passen; es sind keineswegs nur Jazzstücke, sondern auch Orchester- und Kammermusik wie das Klarinettenquintett „Waldgeist“, das demnächst von Mitgliedern der Berliner Philharmoniker uraufgeführt wird. Seine Sprache ist daran gereift, dass er in so vielen Bereichen tätig war: „Studium finanziert mit Barpianospiel, in Singapur und Lima mit der Lederhosn Wiesnmucke gemacht, habe auch Floßfahrten, Beerdigungen, Hochzeiten, Taufen musikalisch umrahmt, in Schottland in Trachtenanzug und Gummistiefeln in Rock Clubs E-Gitarre gespielt, dazwischen Klavierabende mit eigenen Werken, auf irischen Schlössern Opernsänger begleitet, auf der Zugspitze in Schnee und Eis und im Louvre gespielt, Ballettmusik komponiert, in Harlem Free Jazz, in Italien Straßenmusik, Chansonsänger ein Dutzend begleitet, in New Orleans mit Franzosen traditionellen Jazz gespielt, mit Sintis am Lagerfeuer musiziert, Mozart Klavierkonzert mit Orchester gespielt, dann Klezmer mit Giora Feidman in Zürich, Filmmusik eingespielt, Reeperbahn beschallt, Begleitband geleitet in Fernsehsendungen, Theatermusiken geschrieben und geleitet für Nibelungenfestspiele und Dresdner Zwingerfestspiele dann wieder Kammermusik, Cembalomusik, Trompete gelernt, gedichtet, gesichtet, geschmiedet und daneben gelangt, Rhythmusgitarre gespielt, gesungen, Lebensliebe getroffen, traumhafte Kinder bekommen und immer wieder üben …“
Nur um die Elektronik ließ ihn seine Naturliebe (fast) einen Bogen machen: „Die Musik muss menschlich bleiben. Die Musikausübung Maschinen zu überlassen hat für mich nichts mit Fortschritt zu tun. Der Klang muss zunächst direkt mit Menschenhänden erzeugt werden, sonst resoniert nichts in mir. Wird dieser natürlich erzeugte Klang zeitgenössisch verfremdet, habe ich damit kein Problem. Die Wurzel muss der Naturklang sein. … Das ausschlaggebende Gesetz in der Musik und auch im Leben allgemein ist für mich das der Resonanz. Resonanz bedeutet auch ‚Mitschwingen‘ zu können, sich auf einander einzulassen. Der Musiker muss mit seinem Instrument schwingen, mit seinen Mitmusikern, dem Publikum. Das ist nicht immer zu erreichen, aber wenn es passiert, ist es eine der größten Glückserfahrungen für mich.“
www.auwaldtrio.com
Neu erschienen:
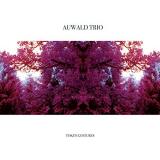
Token Gestures
Auwald Trio
Waterpipe Records
Als JPC- und Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.
Externer Inhalt - Spotify
An dieser Stelle finden Sie Inhalte eines Drittanbieters, die Sie mit einem Klick anzeigen lassen können.
Mit dem Laden des Audioplayers können personenbezogene Daten an den Dienst Spotify übermittelt werden. Mehr Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.
Neobarocke Startrampe
„Token Gestures“, das Debut des Auwald Trios – Christian Ludwig Mayer (p), Ludwig Leininger (b) und Lorenz Rutigliano (d) –, ist in seiner Vielfalt erstaunlich. Mayer, Komponist aller Stücke, hat die putzmunter zwischen den Genres vermittelnde Fantasie eines Jaki Byard, den singenden Anschlag eines Roland Hanna, die romantische Seele eines Robert Schumann und eine Riesenportion Eigenart. Stridepiano oder Neobarockes sind nur eine Startrampe, von der aus es mit irrwitzigem Spielwitz und umwerfendem Swing überallhin gehen kann. Doch die „Token Gestures“ sind keine leeren Stilübungen, sondern echter Selbstausdruck. Auch die rätselhaftironischen Texte offenbaren Esprit.
Marcus A. Woelfle, 11.02.2017, RONDO Ausgabe 1 / 2017
Das könnte Sie auch interessieren
Gefragt
Myung-whun Chung
„Das Klavier ist mein Freund“
Der Dirigent Myung-whun Chung überrascht als Pianist mit einer […]
zum Artikel
Hörtest
Brahms: Streichquartett Nr. 1 c-Moll
Unter den Aufnahmen des 1. Streichquartetts von Johannes Brahms sind etliche Trostpreise und sogar […]
zum Artikel
Gefragt
Christian Ludwig Mayer
Ruf des Waldes
„Unstillbare Neugier auf die Musiktraditionen aller Zeiten und Länder“ treibt diesen […]
zum Artikel
CD zum Sonntag
Ihre Wochenempfehlung der RONDO-Redaktion
Externer Inhalt - Spotify
An dieser Stelle finden Sie Inhalte eines Drittanbieters, die Sie mit einem Klick anzeigen lassen können.
Mit dem Laden des Audioplayers können personenbezogene Daten an den Dienst Spotify übermittelt werden. Mehr Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.
Der Komponist Giacomo Orefice (1865–1922) wuchs in einer jüdischen Familie im norditalienischen Vicenza auf und ist vor allem für sein Opernschaffen bekannt. Auch als Pädagoge macht er sich einen Namen, sein berühmtester Schüler war der Filmkomponist Nino Rota. Orefices bekanntestes Musiktheaterwerk ist „Chopin“, für das er die Klavierwerke des polnischen Komponisten orchestrierte. Seine eigene Klaviermusik umfasst überwiegend romantische Charakterstücke, die von Gedichten, […] mehr




