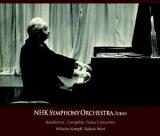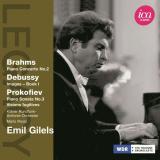Klavierklassiker
Kulturanschlag auf die Anschlagskultur
Mit diesen drei klangtechnisch exzellenten Aufnahmen, den Besten der letzten Monate, gewinnen Sie zu Weihnachten noch das Herz des blasiertesten Sammlers, versprochen!
Endlich wieder auf dem Markt ist die neben Rubinstein herrlichste (ja ein besseres Adjektiv fällt mir nicht ein …) – und pianistisch noch gefeiltere – Gesamtaufnahme der Chopinschen Nocturnes mit Ivan Moravec, begleitet von einem liebenswürdigen Interview mit dem inzwischen 82-jährigen Meister. Ich habe schon oft Hymnen auf Moravec verfasst, man muss der Vollkommenheit gerade in Tagen ausufernden Mittelmaßes huldigen; und bisher ist noch jeder Hörer dem Zauber seines alle mechanischen Härten vergessen machenden Belcantos erlegen.
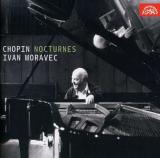
Ein kompletter, nie zuvor veröffentlichter Satz der Klavierkonzerte Beethovens mit Wilhelm Kempff, 1970 in Japan mitgeschnitten, ist das nicht eine kleine Sensation? In seinem japanischen Refugium hatte „Kempu san“ die Lizenz zur schönen Lässigkeit, wer zählte dort schon falsche Töne? Die fast koketten Ideen, mit denen er das Finale des ersten Konzertes glitzern lässt, schienen ihm spontan zuzufliegen. Es waren Abende reiner Musizierlust, feinsinnig-korrekt sekundiert von anbetenden Japanern. Doch er gibt nicht nur den Magier der zarten Innerlichkeit, so schön auch die typischen silbrigen Kempff- Pianissimi hier eingefangen sind, er genießt auch eine gewisse Ruppigkeit an Orten, wo man von ihm die geistreiche Nuance erwartet, gerade im G-Dur-Konzert. Und im fünften Konzert langt er mit der kuriosen Geste des alternden Klavierlöwen zu, was gerade in seiner Unbeholfenheit Beethovens Grimm wunderbar trifft.
Emil Gilels dagegen wurde „alterslyrisch“, legte das Tastenlöwenkostüm ab und nahm sich beim WDR (1971) 20 Minuten, um den Kopfsatz des zweiten Brahms-Konzertes bedächtig durchzukneten, bis ins letzte 16tel mit einer unbeschreiblich warmen Fülle zu beschweren und jede Geste sonor zu bekräftigen. So monumental und privat zugleich ist das Werk nie wieder gespielt worden – nicht einmal von ihm selbst in der Studioversion der Deutschen Grammophon.
Matthias Kornemann, 30.11.1999, RONDO Ausgabe 6 / 2012
Das könnte Sie auch interessieren
Musikstadt
Prag
Drei Opern, vier Orchester, Konzertsäle mit Historismus-Üppigkeit oder Landhauscharakter – Prag […]
zum Artikel
Hausbesuch
HIDALGO Festival
Gegen alle Konvention
Neugierig und nachhaltig, so lautet das Credo des HIDALGO Kollektivs, das den Konzertbetrieb mit […]
zum Artikel
Boulevard
Ein Feuerwerk mit Kontrabass
Ein Schuss Jazz, eine Prise Film, ein Löffel Leichtigkeit
Bunte […]
zum Artikel