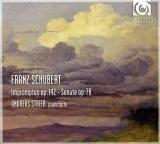Startseite · Interview · Gefragt
Andreas Staier
Das kastrierte Klavier
Cembalist und »Hammerpianist« Andreas Staier ist ein Mann klarer Worte. Im RONDO-Interview mit Robert Fraunholzer gibt er zu, warum er eine Nervensäge ist, wirbt für Misstrauen gegenüber CD-Gesamtzyklen und verrät, was er für Alfred Brendel kocht.
RONDO: Herr Staier, Sie sind von der Musikschule geflogen, weil Sie als »Nervensäge« galten. Sind Sie sich treu geblieben?
Andreas Staier: Ja, ich bin froh über mein unwilliges Image, das ich mir hart erarbeitet habe. Nervensäge zu sein, ist meine Arbeitshaltung. Aber manche in diesem Job kommen einem auch einfach zu blöd! Denken Sie nur an die vielen Interviews. Da geht der eigene Perfektionismus als Rechthaberei durch. Schlimmer wäre: Stumpfheit und das einseitige Schielen auf den Kommerz. Ich will mich nicht heroisieren. Aber man muss abwehren, was man selbst für grundfalsch hält. Und eine Linie ziehen, hinter die man nicht zurückgeht. Das ist der Grund, warum mir die Jugend heute oftmals eher fremd ist.
RONDO: Sie haben, als Sie selbst jung waren, viel improvisiert, aber wenig geübt. Der richtige Weg?
Staier: Ich glaube schon. Der Klavierpädagoge Friedrich Wieck war als penetrant und unsympathisch verschrien. Man würde annehmen, dass er auf Drill seiner Schüler aus war. Das Gegenteil ist der Fall. Er hat die Kinder ohne Noten Klavier spielen lassen. Die wurden erst dazugenommen, wenn die Finger schon warm gespielt waren. Ein auditives Lernen. Hochgezüchtete Wunderkinder, von denen ich viele erlebt habe, versagen, sobald etwas ohne Noten gespielt werden soll. Man sollte berücksichtigen, dass Notenschrift ein Behelf ist, der kapituliert vor den Feinheiten der Musik. Trotzdem wird in der Musikerziehung und in der Instrumentalausbildung die Notenschrift zum Fetisch erhoben. Das ist grundfalsch.
RONDO: War Ihre Entscheidung für Cembalo und Hammerklavier eine solche gegen den Mainstream?
Staier: Nein, sondern für Bereicherung. Beim Basso-continuo-Spiel lernte ich Repertoire kennen, das man sonst nicht serviert bekommt: Frescobaldi und Couperin etwa. Ich habe immer stark ausgewählt, denn ich glaube nicht, dass man alles gleich gut spielen kann.
RONDO: Ist Rachmaninow technisch zu schwer für Sie?
Staier: Ja, davon muss ich die Finger lassen. Wenn man zu lange William Byrd spielt, fällt Rachmaninows Drittes Klavierkonzert irgendwann hinten runter. Aber ich bin froh über meine Nische, in der man auch nicht erwartet, dass ich auswendig spiele. Das ist nämlich eine Unsitte heutiger Pianisten. Die Fuge aus Beethovens op. 106 habe ich – wenn sie ohne Noten gespielt wird – noch nie fehlerlos gehört. Der Betrieb zwingt leider viele Kollegen, auswendig zu spielen. Mein guter Freund Alexander Melnikow hat einmal das Gegenteil versucht – und die Kritiken waren niederschmetternd. Überall stand, dass der Pianist nicht in der Lage sei, auswendig zu spielen.
RONDO: Warum spielen Sie keine Gesamtzyklen ein?
Staier: Ich finde, dass auch die allergrößten Komponisten Nebenwerke geschrieben haben. Am ehesten ist Bach eine Ausnahme von dieser Regel.
RONDO: Sie sind mit Alfred Brendel recht gut befreundet. Was haben Sie für ihn gekocht, als er Sie das erste Mal besuchte?
Staier: Coq au vin. Das kann nicht danebengehen. Der Kochfall hat sich nicht wiederholt. Die Besuche schon. Brendel hat mir einmal zu Hause die Diabelli-Variationen und Beethovens op. 111 vorgespielt. Ich habe noch Abende danach Notizen gemacht. Ich habe Brendel, der viel Humor besitzt, oft CDs von mir geschickt, von denen ich annehmen durfte, dass er sie schrecklich finden wird. Was auch zutraf. Er akzeptiert das Cembalo, aber das Hammerklavier empfindet er als kastriertes Klavier. Ich geb’s zu: Eigentlich hab ich’s ihm gerade deswegen geschickt.
Neu erschienen:
Robert Fraunholzer, 05.04.2014, RONDO Ausgabe 2 / 2009
Kommentare
Daniel Ungermann
Andreas' Staiers trockener Humor und seine Ehrlichkeit sind frappierend. Und etwas Understatement ist auch vorhanden, das macht ihn so sympathisch. Über seine Qualitäten als Interpret auf historischen Tasteninstrumenten muss man nicht diskutieren, nicht nur in technischer Hinsicht. Im Konzert ist die absolute Perfektion seine Sache nicht (in einem Konzert mit den Goldbergvariationen 2010 hörte ich über 100 kleine Imperfektionen), aber das Gesamtergebnis ist überwältigend: Ins letzte Detail durchdacht und trotzdem von absolut natürlicher Wirkung. Und er wenn auf seiner Byrd-CD, wie er in einem Interview sagte, tatsächlich historische Fingersätze benutzt ("Jhon come kisse me now" !), kann man nur den Hut ziehen ! Staier ist wohl immer noch das Mass aller Dinge.
Das könnte Sie auch interessieren
Volt & Vinyl
Volt & Vinyl
Ein bisschen Hollywood
Yo-Yo Ma hat bekanntlich einen ziemlich großen musikalischen Appetit, der von Bach bis zur […]
zum Artikel
Da Capo
Greisin mit Zartsinn
Berlin, Staatsoper Unter den Linden – Janáček: „Věc Makropulos“
Nach 337 Jahren – endlich verjüngt. Die Figur der Emilia Marty in Leoš Janáčeks „Věc […]
zum Artikel
Pasticcio
Mehr Frau wagen
An diesem Wochenende biegt in Köln das [Neue Musik-Festival ACHT BRÜCKEN](www.achtbruecken.de) […]
zum Artikel