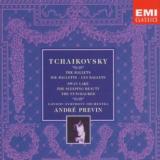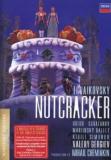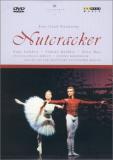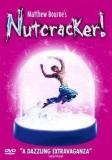Startseite · Medien · Hörtest
Hörtest
Tschaikowskis Ballett »Der Nussknacker«: Von Mäusen und Menschen
Alle Jahre wieder kommen das Christkind und der Nussknacker, nicht gerade Hand in Hand, aber beide zuverlässiger als Knecht Ruprecht, der im finstern Tann gerne mehr über den Durst trinkt, als ihm bekömmlich ist. Durch die Fülle von Aufnahmen des Tschaikowskiballetts auf dem Gabentisch krabbelte sich Thomas Rübenacker zu ein paar wahren Perlen vor.
Damals
Sobald’s in der behaglichen Stube, nach bekömmlichem Christfest-schmause, so gar recht lauschig wurd’ im Widerschein der Kerzlein, nachdem die Muhme ihr Pianoforte-Accompagnement von »O Tannenbaum« exekutiert hatte und keines der Lieben mehr in den Begriff »Völlegefühl« zu entbrechen vermochte – gedachte der Vater im Bratenrock zum CD-Player zu pilgern, woselbst er das Ballett »Der Nussknacker« von Tschaikowski zu Gehör zu bringen gedachte. Allein, es war ihm nicht vergönnt, alldieweil in der guten alten Zeit des Biedermeiers a) »Der Nussknacker« noch 50 Jahre warten musste, bis es ihn gab und b) der CD-Player noch runde 150. Es blieb lediglich zu gewärtigen, dass der Vater ein Pfeiflein schmauchen würde, die Mutter an ihrem Stramin nadeln, der Tannenbaum auch ohne denselben, dass die Anverwandten die Karten dreschten (Doppelschafskopf) und die Kindlein mit ihrem neuen Nussknacker spielen würden: Weihnachten anno 1831. Dazumalen, wie gesagt, gab es das Ballett »Der Nussknacker« noch nicht – Peter Iljitsch Tschaikowski komponierte es so, dass es 1892 uraufgeführt werden konnte (julianisch/gregorianischer Kalender). Aber seither ist es aus der Weihnacht nicht mehr wegzudenken. Verwegene Wandertruppen mit Fantasienamen wie »Grand Ballet de Paris« oder »Bulgarisch-Mazedonisches Staatsballett« gastieren in der Stadt und führen uns meist vor, dass ein Nussknacker nun mal aus Holz ist.
Heute
Heute legt Vati eine der Orchestersuiten oder eine gute Gesamtaufnahme auf DVD in den Player, und der Weihnachtsabend ist gelaufen. Deren gibt es nicht wenige (Aufnahmen und Weihnachtsabende). Fast alle »Nussknacker« auf Ton- und Bildträger sind irgendwie gut, manche mehr, manche weniger, mal steifer, mal agiler, mal mehr Ballett-, mal mehr Konzertaufführung. Der sensualistischen Qualitäten der Partitur wegen lassen wir die Monoaufnahmen aus der Steinzeit einmal weg, obwohl es auch da Beachtliches gibt (allerdings nicht gerade Toscanini ...). Aber eine farbenfrohe Stereoaufnahme mit gutem Orchester und Dirigenten, die suchen wir uns nicht erst unterm Weihnachtsbaum.
Vielleicht anfangs noch ein paar Worte zur Handlung, auch wenn die von Aufführung zu Aufführung schwankt. Tschaikowski nutzte als Vorlage E. T. A. Hoffmanns Märchen vom »Nussknacker und Mausekönig« aus der Sammlung »Die Serapionsbrüder«, allerdings in der etwas beschwichtigenden Fassung von Alexandre Dumas père, die in Russland damals sehr beliebt war (auch konnte der Komponist besser Französisch als Deutsch). Kurz umrissen, geht es um Folgendes: Im bürgerlichen Wohnzimmer des »Präsidenten« (bei Hoffmann ist das schlicht Medizinalrat Stahlbaum) mit den Kindern Clara und Franz (bei Hoffmann: Marie und Fritz) wird, am Weihnachtsabend, ein alter Märchenkonflikt in der Stellvertreterwelt der Spielzeuge ausgetragen – Mäusebrut gegen Menschen, wobei die Mäuse oder eigentlich Ratten für das Böse im Menschen stehen, die »eigentlichen« Menschen aber, angeführt von einem Nussknacker (= verzauberter Prinz) für das Gute. Die spannendste Figur im Spiel ist der Onkel Drosselmeyer, ein typisch hoffmannesker Puppenspieler und Uhrmacher, mal gütig, mal dämonisch, der den genialen Automatenkonstrukteur Spalanzani aus Offenbachs Oper »Hoffmanns Erzählungen« mit dem einäugigen Wotan aus Wagners »Ring des Nibelungen« verbandelt. Drosselmeyer, der geniale Ingeniör, hat mit einer Supermausefalle mal einen Palast nahezu nagerfrei gemacht. Darum wurde sein Neffe, der Prinz, in einen hässlichen Nussknacker verwandelt. Jetzt aber ist die Stunde gekommen zum Endkampf Gut gegen Böse! Die kleine Clara Stahlbaum fungiert dabei als Katalysator: Wie die Senta im »Fliegenden Holländer« entscheidet ihre Liebe letztlich über den Sieg des Guten. Übrigens hat E. T. A. H. das für zwei tatsächliche Kinder entworfen – für eine Marie und einen Fritz, Sohn und Tochter seines Freundes Julius Eduard Hitzig, der in seltener Personalunion Kriminalbeamter und Zeitungsverleger war.
Ich sehe, was du nicht hörst
Beginnen wir mit der DVD, schließlich handelt es sich um ein Ballett. Eine der besten Compagnien Europas, das Londoner Royal Ballet Covent Garden, hat den »Nussknacker« gleich zweimal herausgebracht, 1985 und gegen Ende des letzten Jahrhunderts. Im Wesentlichen ist das zweimal die gleiche Inszenierung, Peter Wright bastelte noch ein bisschen an Marius Petipas Libretto und an Lew Iwanows Choreografie herum, in beiden Versionen. Aber welch ein Unterschied! Die ältere von 1985 hat die schlechtere Bild- und Tonqualität, Gennadi Roshdestwensky leitet das Orchester geradezu hastig, fahrig und grob (als ob er noch die letzte U-Bahn nach Mayfair kriegen muss), auf der Bühne bleibt vieles skizzenhaft, was später perfektioniert wurde. Und dennoch passiert hier die reinste Magie! Ein genial-dämonischer Drosselmeyer mit schwarzer Augenklappe (Michael Coleman) ordnet fast wie Graf Dracula das Geschehen an, er ist der Spielmacher, der Maître de Plaisir (oder de la peur, der Angst). Schon bei seinem Auftritt wirft das potenzielle Grauen seine Schatten voraus: Die biederbürgerliche Weihnachtsgesellschaft erstarrt zum Wachsfigurenkabinett – außer der kleinen Clara (getanzt von der äußerst liebreizenden Julie Rose).
In der neueren Version dirigiert Evgeny Svetlanov sehr, sehr vorsichtig, sein Hotelzimmer ist wahrscheinlich grad um die Ecke von Covent Garden, aber mitunter klingt es auch einfach nur sämig und tranig. Drosselmeyer (Anthony Dowell), tollkühn!, ein Wunder!, sieht wieder auf beiden Augen, hat so gar nichts Dämonisches mehr und bezirzt eine passenderweise eher biedere Clara (Alina Cojocaru) mit Zauberkunststückchen, wie sie auch beim Magischen Zirkel Berlin Marzahn mühelos beherrscht würden. Alles in dieser Neuversion ist perfekter, das Orchester spielt besser, die Aufnahmetechnik glänzt heller, die Tänzer sind agiler, Verlegenheitslösungen der Erstversion wurden ausgebügelt. Aber auch der Charme ging flöten und die Magie verpuffte, also alles, was das Werk groß macht. Sic transit gloria mundi. Oder was meinen Sie?
Home, sweet home
Nie mehr fand sich ein ähnlich suggestiver Drosselmeyer wie Michael Coleman in all den anderen Aufnahmen, selbst in den besten nicht. Und eine so anrührende Clara – außer einer einzigen, auf die wir noch zu sprechen kommen. Aber gehen wir jetzt ruhig mal ins Mutter- oder Vaterland dieses Ballettjuwels, nach Russland. Hier wird teilweise noch im »period style« aufgeführt, nach alter Väter (Petipa/Iwanow) Sitte. Auch vom Uraufführungsort, früher: Marien-, heute: Mariinsky-Theater in St. Petersburg, gibt es eine ältere und eine neuere Aufnahme. Die ältere von 1994 beginnt ganz wunderbar: Ein gewisser Victor Fedotov dirigiert die Ouvertüre mit straffer Präzision, aber nicht ohne Poesie, weder fahrig wie Roshdestwensky noch tranig wie Svetlanov, während die Kamera diverse Kinder im Publikum aufstöbert – lauter kleine Claras im Festgewand und mit Schleife im Haar, wie sie dasitzen und lauschen, gespannt oder gelangweilt, gebannt oder selbstvergessen. Dann geht leider der Vorhang auf, und alles versinkt in butzenscheibiger Beliebigkeit. Wenig Charme, null Magie, null Dämonie. Getanzt wird zwar formvollendet, aber weitgehend sinnfrei, und die Kamera verharrt zumeist in faden Totalen, die dem Betrachter schmerzhaft einhämmern, dass die Interieurs und die Kostüme genau so fade sind. Als Drosselmeyer auftritt (Piotr Russanov) und wie eine Frau wirkt, so in etwa: Tante Käthe, kann man sich den Rest sowieso schenken. Das ist wie Spielstand 3:0 ein paar Sekunden vor Spielende, nämlich nicht mehr aufzuholen. Schade. Schade für den schönen Beginn.
Die neuere Kirowaufnahme, 2001 dirigiert von Valéry Gergiev, »adaptiert von Mikhail Chemiakin, mit neuer Choreografie von Kirill Simonov«, ist da von ganz anderem Holz. Beziehungsweise weitestgehend holzfrei. Die Ouvertüre wird noch konventionell bebildert mit dem Dreitagebart des Dirigenten, aber dann geht der Lappen hoch und die Fetzen fliegen, Spielideen und schiere Vitalität werden rausgepulvert, dass es für drei Aufführungen reichen würde. Schon Stahlbaums Küche zu Beginn ist bunter als das Zauberland von Oz, und weiter geht’s geradezu psychedelisch, ein LSD-Trip mehr als eine beschauliche Weihnachtsfeier. Drosselmeyer (Anton Adasinsky) ist ein buckliger Verrenkungskünstler mit weißem Kahlschädel und abstehenden Ohren, so insektenhaft wie der Stummfilm- Vampyr Nosferatu, aber trotzdem nicht halb so dämonisch wie Michael Coleman bei Peter Wright. Das Zentrum der Aufführung heißt Clara beziehungsweise hier Mascha (Irina Golub), kein wunderbares Schneeflockenkind wie Julie Rose, sondern ein kesses Energiebündel, das bisweilen auch so tanzt, als wäre längst schon das Jazz-Zeitalter ausgebrochen. Das Libretto wurde wieder mehr in Richtung E. T. A. Hoffmann hingebogen, auch wenn es manchmal wirkt wie »Alice im Wunderland«. Hier passiert so viel, dass man eines beinahe übersieht: Was schon so exzentrisch-dampfend beginnt, hat kaum noch Steigerungsmöglichkeiten, wenn’s dann endlich abgeht in die Spielzeug-und-Zucker-Welt. Trotzdem, eine der besten Versionen. Sozusagen: Federico Fellini goes E. T. A. Hoffmann. (Die Moskauer Konkurrenz vom Bolschoi-Ballett ist vor allem eines: edel. Edle Musik, edle Tänze, edle Dekoration. Zum Davonlaufen.)
Trivia
Eigentlich ist die »Nussknacker«-Dramaturgie ja ziemlich beknackt: Wo E. T. A. Hoffmann noch mal kräftig aufdreht, endet das Ballett im Raffinierzucker, laut Libretto von Petipa und Wsewoloschsky, nach Entwürfen des Tschaikowskibruders Modeste. Zwei Teile, zwei Akte: Der erste feiert Weihnachten im Hause Stahlbaum, mit Drosselmeyerzauber, mitternächtlichem Mäusekampf und Schlittenfahrt durch die Schneeflöckchen. Erwachsene amüsieren sich gut, Kinder sind oft gelangweilt. Dann der zweite Akt: ein Charaktertanz nach dem andern, gipfelnd allerdings im großen Pas de deux Zuckerfee/Prinz. Dennoch – hier freuen sich die Kinder, Papa und Mama gähnen. Es wird im ersten Akt einfach zu viel angeschnitten, um in Sahneschnittchen mit Trinkschokolade zu enden.
Aber die Musik ...! Tschaikowskys »Schwanensee« ist musikalisch bestimmt verführerischer, »Dornröschen« kontrapunktisch straffer – aber der »Nussknacker« hat beides in großer Harmonie, er ist und bleibt des Komponisten Tanzmeisterwerk. Kleine Anekdote am Rande: Wie raffiniert Tschaikowski seine klangfarblichen Effekte kalkulierte, möge das Beispiel der Celesta illustrieren. Das Ding, das gespielt wird wie ein Klavier, aber klingt wie ein weicheres Glockenspiel, also wie Glöckchen, wurde erst 1886 in Frankreich erfunden und patentiert bei der Pariser Firma Mustel. Tschaikowski weilte gerade dort, hörte es klingeln und dachte sich: Das muss mit! Er schmuggelte ein Exemplar im Zug nach St. Petersburg (den Zoll hätte es erst nach Monaten und einigem Aufsehen passiert), dann ließ er es unter größter Geheimhaltung im Orchestergraben des Marientheaters installieren. So waren ihm bei der Premiere, und nicht erst beim Tanz der Zuckerfee, schon mal Extra-«Ohs!« und -«Ahs!« seines verwöhnten Petersburger Publikums sicher. Es war nicht grade das wiedererfundene Rad, aber ein wunderbarer Klang aus Nirgendwo –
das französische Wort céleste bedeutet zu Recht »himmlisch«.
Stirb und werde
Wir entfernen uns weiter und weiter vom Original – aber was ist hier »das Original«? E. T. A. Hoffmanns Märchennovelle oder das Libretto von Marius Petipa, der relativ rasch gelangweilt an seinen Assistenten Lew Iwanow übergab? Oder Modeste Tschaikowskis Laienpantomime aus dem weihnachtlichen Wohnzimmer? Gar die Wünsche des Komponisten, der eigentlich selbst nur Wünsche erfüllte? Wurde ihm gesagt: »Hier bitteschön 15 Takte blabla und dann, nach sechs Takten Übergang, noch 32 Takte blublu!« – dann führte Tschaikowski das aus, nein: erfüllte er das mechanistische blabla-blublu mit Leben. Ist »Der Nussknacker« letztlich also Freiwild, offen für immer freudianischere Deutungen von der Metamorphose eines Mädchens zur Frau? Es sieht so aus. Aber das ist noch lange nicht alles.
Einen »Nussknacker« kriegt man auch hin ganz ohne Nussknacker, zum Beispiel durch eine Mischung aus »Hänsel und Gretel«, »Bei Hempels unterm Sofa« und Astrid Lindgrens Bullerbü-Welt. Womit wir in Schweden wären, an der Königlichen Oper Stockholm. Hier heißt das Werk »Der Nussknacker oder Petter und Lotta und Weihnachten« und basiert mehr auf Elsa Bes kows Kinderbuch »P. und L. und W.«, den Schweden ungefähr so vertraut wie uns der »Struwwelpeter«. Hier regiert ein völlig ausgewechseltes Personal (Onkel Blau, Tante Braun, Tante Grün usw.) eine Geschichte, worin zwar noch ziemlich unmotiviert ein Mäusekrieg stattfindet, aber sonst kein Stein auf dem andern bleibt. Der Prinz ist ein Köhler, die Zuckerfee ein Dienstmädchen, und Lotta/Claras Liebe rettet niemanden, am wenigsten ihren Bruder Petter, mit dem sie sich von A bis Z kabbelt. Gewiss ist das eine der komödiantischsten und charmantesten Aufführungen, hervorragend getanzt und choreografiert (Pär Isberg), aber wo bleibt der Konflikt? Stattdessen werden Minikonflikte injiziert, die sich stets als Mummenschanz entpuppen, und die Nummernrevue beginnt schon im ersten Akt. Am Ende bleibt das Gefühl, diese ohne Zweifel schöne Aufführung sei doch nur so gewesen, wie Schweden sich schon immer sah: neutral. Das Gegenteil von neutral kommt jetzt, nämlich eine DVD, die mit der erstgenannten aus Covent Garden mithalten kann, was Charme und vor allem Magie angeht, auch wenn sie völlig andere Mittel anwendet: die aus der Deutschen Staatsoper Berlin.
Hier spricht Dr. Sigmund Leid
Charme kann man, wenn man ihn denn hat, anknipsen wie ein Radiogerät, Magie nicht. Deshalb verblüfft es, wie viel Sogkraft diese Berliner Variante entwickelt, obwohl sie von Sigmund Freuds Psychoanalyse verseucht ist wie eine Wohnung vom Wasserrohrbruch im Stock darüber. Was weitestgehende Konsequenzen für die Geschichte hat: Die kleine Heldin wird zu einer Art Anastasia, vermeintlich die einzig überlebt habende Tochter der Zarenfamilie Romanow, deren emotionale Bindung an ihren alten Spielzeugnussknacker die Hoffmanngeschichte völlig ummodelt – allerdings so, dass es E. T. A. vermutlich sogar gefallen hätte. Plötzlich kommen so seltsame Dinge wie Fetischismus, Flugträume, Ödipuskomplex oder Dreiecksfantasien ins Spiel. Aber seltsam – das stimmt in sich, und es ist einfach höllisch spannender als die Bullerbü-Welt aus Stockholm oder das Traditionsgewurstel aus Russland. Der Psychoanalytiker, der das choreografierte und inszenierte, heißt Patrice Bart, und er hatte mit Nadja Saidakova eine Protagonistin, die unglaubliche Präsenz mit unglaublicher Suggestion vereint – die das gewagte Konzept wirklich trägt. Ganz anders als Julie Rose (in der alten Wright-Version war Onkel Drosselmeyer das Alphatier), aber so, dass man nur darauf wartet, wie sie mit ihrem Nussknackerfetisch wieder irgendwas alleine tanzt. Da ist sie dann nämlich wieder, die gute alte Magie. Was das im Unterbewussten alles zu bedeuten hat: keine Ahnung. Es hat eben jeder sein eigenes Unterbewusstes. Der zweite Akt ist dann wieder nur Nummernrevue, aber vom Allerfeinsten. Und das Bühnenbild, immerhin, sieht noch aus wie ein Rorschachtest. Erfahren kann man in Patrice Barts erstem Akt »Nussknacker«, dass Ballett die ultimative Stilisierung menschlicher Beziehungen ist, nicht nur das Warten auf den nächsten Pas de bourrée. Und Barenboim dirigiert einen langsamen (= gut tanzbaren) Klangteppich, zugleich aber einen der kundigst geknüpften auf DVD.
Das Phantom des Balletts?
Die allergrößte Überraschung kommt naturgemäß aus einer Ecke, woher man sie am allerwenigsten erwartet hätte. Die bonbonfarbene DVD-Hülle nennt Tschaikowskis Namen nur noch im Kleingedruckten auf der Rückseite, die Front beherrscht »Matthew Bourne’s Nutcracker!« und der Hinweis aus der Zeitung Sunday Telegraph, es handle sich um »a dazzling extravaganza«, eine blendende Extravaganz. Schon fürchtet der Beckmesser, den »Nussknacker« hier als Quasimusical serviert zu bekommen, irgendwie in Richtung Andrew Lloyd Webber. Und tatsächlich wird es grell, respektlos, bisweilen sogar vulgär – aber zugleich so lustig, wie Ballett noch nie war (außer, es geht etwas schief). Mit den Mitteln des klassischen Tanzes werden Einfälle gezündet wie in den letzten zehn, zwölf Filmkomödien nicht: Selten so gelacht, und schon gar nicht beim »Nussknacker«. Das Royal Philharmonic Orchestra spielt unter Brett Morris kein Jota schlechter als die Kollegen von anderswo, und auf der Bühne findet Weihnachten in einer Art Erziehungsanstalt wie bei Charles Dickens statt, aber so, dass die Kamera nie weiß, wo sie hingucken soll – es passiert immer irgendwo etwas Pointiertes. Sogar die Nummernrevue des zweiten Aktes hat noch diesen schrägen Witz, und dann verzichtet der Zuschauer auch gerne auf Charme und Magie (obwohl es sogar das gibt bei »Matthew Bourne’s Nutcracker!«). Kurz gesagt: Hier schlägt das pure Vergnügen zu, ohne die Kunst dabei totzuschlagen. Hut ab! Das Ausrufezeichen hinterm Kurztitel hat diese Produktion sich jedenfalls mehr als verdient, sie ist einfach eine doppeldicke Scheibe Lebensfreude. Und das kann man immer brauchen.
Befreit von den Fesseln, Tänzer auf der Bühne nicht überfordern zu dürfen, kann Tschaikowskis »Nussknacker« in einigen erstklassigen CD-Gesamtaufnahmen volle Klangpracht entfalten. Von Karajan gibt es keine, obwohl seine Auswahl (DG 419 175-2) eine solche nahegelegt hätte: Der Klangsensualist aalt sich mit den Berliner Philharmonikern in den Höhepunkten, aber eben nur in diesen. Gleich abhaken kann man den groben, plakativen, aber effektvollen Richard Bonynge mit dem National Philharmonic Orchestra (Decca 467 771-2) und den DVD-Soundtrack mit Valéry Gergiev, der fast nur grob ist, ohne schöne Effekte (Philips 462 114-2). Es kann eigentlich nur besser werden, aber das wird’s im Quantensprung: Seiji Ozawa mit dem Boston Symphony Orchestra, Antal Doráti bzw. André Previn mit dem London Symphony und Semyon Bychkov mit den Berliner Philharmonikern sind allesamt erstklassig. Das Schöne dabei aber ist: Sie sind es auf je eigene Art! Am weitesten befreit sich von der Notwendigkeit zur Tanzbegleitung Antal Doráti, dessen Gesamt-»Nussknacker« wie eine einzige, groß angelegte sinfonische Suite wirkt, dabei straff, sehnig, energiegeladen – also letztlich doch wieder tänzerisch. Die zärtlichen Seiten der Partitur aber werden nicht unterschlagen, auch nicht ihr Charme oder ihre Magie. Die Aufnahme von 1962 entstammt dem zu Recht berühmten »Mercury Living Presence 35mm«-Programm, was bedeutet, sie wurde in der (immer noch) Stereosteinzeit mit nur drei Mikrofonen rein akustisch auf Filmmaterial aufgezeichnet und verblüfft auch heute noch als ein Klangfest, das die meisten neueren Digitalaufnahmen in den Schatten stellt. Und dann hatte auch das London Symphony Orchestra, das damals sogar noch besser war als heute, eine Sternstunde – hinreißend!
Hier könnte man glatt aufhören, aber das wäre nicht fair den anderen Spitzenaufnahmen gegenüber. Mit zwar nicht ganz demselben, aber dem gleichen London Symphony Orchestra legte André Previn 1972, also zehn Jahre später, eine Gesamtaufnahme vor, die wieder auf Ballettgepflogenheiten zurückgeht, die auch ein bisschen unter Multi-Mikrofonitis leidet, ansonsten aber in ihrer großen Klangwärme und dem wunderbar nostalgisch ausphrasierten Märchenduktus ebenfalls hochgelungen ist. Da wird es dann die reine Geschmacksfrage, ob man’s lieber heimeliger und ein wenig klangdiffus hat – oder als mitunter blendend brillantes Licht wie bei Doráti. In dieselbe Kerbe wie Previn haut auch Seiji Ozawa mit den Philharmonikern von Boston: Der einstige Karajanprotegé malt die sensualistischen Reize der Partitur mit dickerem Pinsel, aber nie sämig oder tranig, die Musik behält ihre nervöse Innenspannung. Die Aufnahme aus der Bostoner Symphony Hall hat den längsten (natürlichen) Nachhall, aber auch das stört nicht, im Gegenteil, es trägt zum Märchenton aus vergangener Zeit bei und rundet die ohnehin schon hervorragenden Holzbläserleistungen noch weiter ab. Hier könnte man wiederum aufhören, aber es gibt ja noch Semyon Bychkovs Berliner Aufnahme mit den dortigen Philharmonikern – den Weltmeistern an Holzbläserdelikatesse und (so sehen sie sich selbst) ohnehin weltbestes Orchester.
Kracks!
Tatsächlich fällt dann hier nicht das eine oder andere Detail auf, sondern ein bezwingendes Ganzes: »Der Nussknacker« wiederum als sinfonische Suite (des ersten Aktes) mit einer Handvoll Divertissement-Zugaben (des zweiten Aktes), die geradezu Kadenzencharakter haben, weil’s ja dann doch wieder ins apotheotische »große Schließen« gebogen wird. Bychkov kann keine Mozart- oder Haydnsinfonie dirigieren, aber wenn es um Effekt geht, ist er nicht zu schlagen. Und darum geht es im »Nussknacker«, auch die zärtlichen Verlangsamungen und Wiederbeschleunigungen (etwa im »Weihnachtsbaum«-Titel) sind letztlich Effekte. Und keiner kalkuliert die wie Bychkov, seine Aufnahme ist die rhapsodischste von allen, stolz dahintreibend wie ein Schwan auf blendend spiegelnder Wasserfläche. Ich kann nicht ernsthaft eine Empfehlung abgeben zwischen Antal Dorátis so völlig anderer Gesamtaufnahme und dieser aus Berlin – außer: am besten beide haben. Welche dann am Weihnachtsabend oder sonst wann in stiller Stunde aufgelegt wird, sollte der Stunde überlassen bleiben. Falsch machen kann man nichts mit diesem Stück – oder mit diesen Einspielungen. Der geniale Uhrmacher Drosselmeyer heißt nämlich in Wahrheit Pjotr Iljitsch Tschaikowski, und seine nussknackerischen Handlanger sind Antal Doráti oder Semyon Bychkov. Oder André Previn. Oder Ozawa. Aber nein, jetzt Schluss, bitte! Auch die dramatischste Weihnacht endet irgendwann mal. Nächstes Jahr wird wieder geknackt.
Die Besten (CD):
Die Besten (DVD):
Thomas Rübenacker, 19.04.2014, RONDO Ausgabe 6 / 2008
Das könnte Sie auch interessieren
Gefragt
Matthias Rüegg
Nie mehr betteln
Mit dem Vienna Art Orchestra schuf der Komponist und Pianist Meilensteine des europäischen Jazz. […]
zum Artikel
Hausbesuch
Carl Nielsen Festival
Strandurlaub für Klangkörper
Romantiker der Moderne: Die Dänen widmen ihrem Nationalheiligen Carl Nielsen ein Festival auf […]
zum Artikel
Pasticcio
Happy End!
Selbst die unnachgiebigsten Verfechter der deutschen Sprachkultur werden diesen Top-Hit Nr. 1 unter […]
zum Artikel