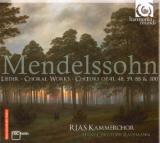60 Jahre RIAS Kammerchor
Berliner Luft
60 Jahre kontinuierliche Chorarbeit formte aus dem RIAS Kammerchor ein international herausragendes Spitzenensemble. Einst war Ellen Malecek jüngstes Mitglied der neu gegründeten Truppe. RONDO-Autor Jörg Königsdorf besuchte sie in ihrer weiträumigen Charlottenburger Fünfzimmerwohnung.
Vermutlich muss Ellen Malecek ihren jüngsten Enkeln schon erklären, was es mit den vier merkwürdigen Buchstaben im Namen ihres ehemaligen Arbeitgebers überhaupt auf sich hat. Dass sich hinter dieser Abkürzung nämlich nicht nur die Wortschlange »Rundfunk im amerikanischen Sektor« verbirgt, sondern auch ein ganzes Kapitel Berliner Nachkriegsgeschichte. Ein Kapitel, das Ellen Malecek quasi von Anfang an miterlebt hat: Als die junge Sängerin 1949 aus Leipzig kam, suchte der wenige Monate zuvor gegründete Kammerchor des neuen Senders noch einen Sopran zur Komplettierung seiner 35-köpfigen Besetzung. Malecek bestand das Vorsingen und wurde jüngstes Chormitglied – natürlich erst, nachdem sie von der Besatzungsbehörde gründlich auf ihre politische Zuverlässigkeit hin geprüft worden war. Sie blieb schließlich 38 Jahre und ist heute beinahe die Letzte, die erzählen kann, wie alles anfing. »Zu Beginn haben wir einfach alles gemacht, von A-cappella-Literatur bis Oper, von Auftritten mit dem hauseigenen Tanzorchester bis zur großen Chorsinfonik«, erzählt sie. »Den einen Tag haben wir eine Platte mit deutschen Volksliedern aufgenommen, den nächsten dann Operettenarien mit Brigitte Mira und auch bei den Sabbatfeiern mit dem Kantor Estrongo Nachama haben wir regelmäßig mitgewirkt.«
Vor allem ging es in diesen Jahren darum, Musik für den Sender aufzunehmen und überhaupt ein Archiv aufzubauen – zum Spezialistenensemble wurde der Kammerchor erst, als dieser tägliche Produktionsdruck etwas nachließ. Dennoch, beteuert Malecek, habe sie diese Anfangsjahre genossen – auch wenn der Chor auf seinen ersten Konzerttourneen in den Fünfzigerjahren noch bescheiden im Autobus reiste und in drittklassigen Hotels logierte. »Wir hatten ja das Glück, in Berlin schon bald die großen Dirigenten wie Ferenc Fricsay und Karajan zu erleben.« Vor allem Fricsay, der als Chef des ebenfalls neu gegründeten RIAS-Sinfonieorchesters am engsten mit dem Chor zusammenarbeitete, habe sie mit seinem Temperament mitgerissen, erinnert sich Malecek, »der war einfach ein Vollblutmusiker, allerdings auch gnadenlos in seinen Anforderungen«. Karajan dagegen habe immer sofort am Legato gearbeitet, an ihm beeindruckte sie vor allem, dass er alles auswendig dirigiert habe. Die zahlreichen Schallplatten aus dieser Zeit bezeugen jedoch nicht nur das schnell wachsende Prestige des neuen Chores, sondern sie zeigen auch einen Chorklang, der ebenfalls schon Geschichte ist. Der bis 1972 amtierende Chorleiter Günther Arndt habe noch einen Chorstil gepflegt, der ein deutlicheres Profil der einzelnen Stimmen erlaubte – so beschreibt es Malecek. Sein Nachfolger Uwe Gronostay setzte dagegen eine völlig andere Klangidee durch: schlank, instrumental und von perfekter Homogenität – eine Umstellung, die nicht eben einfach war. »Manchmal schritt er die Reihen ab, um zu hören, wer da nicht ganz korrekt intonierte. Das war gnadenlos und zu Anfang waren wir alle am Boden zerstört.« Mit seinen Klangvorstellungen lag Gronostay freilich im Trend der Zeit: International gesucht wurden Chöre, die den kontinuierlich steigenden Perfektionsmaßstäben gerecht wurden und auch die Schwierigkeiten zeitgenössischer Musik meistern konnten. Sogar Gronostays Nachfolger Marcus Creed, der das Profil wiederum in Richtung Alte Musik veränderte, erlebte Ellen Malecek Mitte der Achtzigerjahre noch mit – wenn auch nur als Pianisten. Es sei doch normal, dass jeder Chorleiter sein persönliches Klangideal durchsetzen wolle, sagt sie. Dirigenten würden das mit ihren Orchestern schließlich auch tun. Und in einem Ensemble sei jeder eben auch nur eine Nummer, die einfach funktionieren müsse. Aber immerhin eine glückliche Nummer.
Neu erschienen:
Jörg Königsdorf, 03.05.2014, RONDO Ausgabe 5 / 2008
Das könnte Sie auch interessieren
Blind gehört
Vadim Gluzman: „Was ich spiele, entscheidet mein Bauch“
Seit einigen Jahren bereits genießt Vadim Gluzman ein selten gewordenes Privileg: Carte blanche […]
zum Artikel
Testgelände
Christoph W. Gluck
Kein Reform-Opa
Viel gelobt, wenig gespielt: Das ist auch im Jahr von Glucks 300. Geburtstag nicht anders. Aber es […]
zum Artikel
Hausbesuch
Händel-Festspiele Halle
Happy Birthday & Halle-luja!
Vor genau 100 Jahren ehrte die Geburtsstadt Händels den großen Barocksohn erstmals mit einem […]
zum Artikel