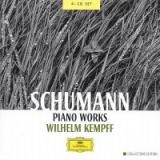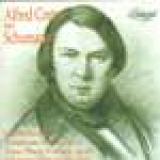
Robert Schumann
Sinfonische Etüden op. 13
Alfred Cortot
Piano Library/Klassik-Center Kassel PL 259.261
(1929) 3 CDs, Komponiert: 1834, Uraufführung: Datum unbekannt; ADD, mono
Als JPC- und Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen