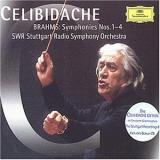
Johannes Brahms
Die vier Sinfonien
Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, Sergiu Celibidache
Deutsche Grammophon 459 635-2
(3/1974, 4/1975, 10/1976, 11/1976) 3 CDs
Nein, bei Celibidaches Brahms-Zyklus fragt kein schüchternes Greenhorn - auch wenn es bereits dreiundvierzig Jahre alt ist und zweiundzwanzig Jahre experimentiert hat -, ob es denn auch noch eine Sinfonie schreiben könne - nach Beethoven mit seinen neun Titanen-Kindern. Hier tritt vielmehr Johannes der Große auf: machtvoll, gravitätisch - hier ist meine c-Moll! Sirenenhaft bis zum Zerreißen lässt Celibidache die Geigen beginnen, um dann kathartisch ins Pianissimo abzutauchen. Diese dynamischen Extreme werden zum Fanal des ganzen Sinfonien-Vierlings, den Celibidache in seinen Stuttgarter Jahren zwischen 1974 und 1976 mit dem dortigen Radiosinfonieorchester im Mannheimer Mozartsaal und der Stuttgarter Liederhalle einspielte - natürlich nicht auf die verteufelte Schallplatte, sondern in Konzerten, die der Rundfunk mitschnitt.
Auch wenn die Einleitung oder auch der kaum noch vernehmbare Pizzicato- Beginn des vierten Satzes der Ersten in typisch Celischer Dehnungsbreite daherkommt, auch wenn manche Phrase sich zäh dahinschleppt: solche sonst nicht spärlichen subjektiven Manierismen sind hier die (wenn auch charakteristische) Ausnahme, angenehm forsche Tempi herrschen vor. Kraft und Stringenz, grandiose Spannungsbögen, jene dynamischen Extreme, aber auch ein denkbar feines Gespür für Klangfarben und Stimmengewebe - sie sind die Meriten der drei CDs. Vielleicht liegt es am Klangbild der siebziger Jahre (trotz “Remastering”), aber die Streicher scheinen Celibidaches Lieblings-, die Blechbläser seine Stiefkinder gewesen zu sein.
Entfernt Celibidache beim c-Moll-Werk strikt alles Zaghaft-Tastende des Erstlings, so entzieht er sich in der Zweiten dem Klischee ungebrochener Heiterkeit und Sommerfrische eines Verliebten. Es gibt die Idylle, aber ihr wird etwas Drohend-Dräuendes unterlegt. Seltene Tempo-Kontraste begegnen uns in der Dritten, insbesondere ihrem Kopfsatz, der, vom Seitenthema abgesehen, geradezu hastig “con brio” präsentiert wird. In den beiden warmen, bedächtig ausgeloteten Mittelsätzen dürfen die Bläser mit betörendem Schmelz aufwarten - ein Musterbeispiel für Celibidaches Fähigkeit, Klangfarben wie Prismen auseinanderzulegen und wieder zusammenzufügen. Ungewöhnliche Leidenschaften brechen sich im harsch rhythmisierten Beginn des Finalsatzes Bahn, bevor das Werk geradezu statisch sinnierend, jedoch mit filigranen Geigenstimmen durchwebt, ausklingt.
Und die Vierte, diese ach so Männlich-Herbe? Bei Celibidache ist sie zunächst die unendliche Legatoreiche, die Kammermusikalische, die Zurückhaltende. Zur Meditation in Sachen melancholischem Farbenspiel modelliert er das “Andante”. Im “Allegro giocoso” aber müssen die Stuttgarter alles an Brillanz zeigen, was sie in ihren Lehrjahren bei Celibidache zwischen 1972 und 1983 gelernt haben. Die Passacaglia offeriert nochmals die typischen Dehnübungen. Dass gerade hier in den langsam angegangenen Variationen kein Quentchen Spannung verloren geht, zeigt gerade das scheinbar so unscheinbare, denkbar intensive Flötensolo. Man glaubt, in jedem ihrer Töne die Autorität jenes Dämons zu spüren. Armer Flötist (vielleicht), glücklicher Hörer!
Noch zwei Worte zu Beiheft und Mitschnitt. Offenbar ist eine Celibidache-CD noch immer ein Unikum, ein Widerspruch in sich. Selten grotesk windet sich jedenfalls eine CD wie diese, um ihre eigene Existenz zu rechtfertigen. Schlicht überflüssig sind die Entschuldigungen des Sohnes und der Mutter, die den Willen des Vaters bei der postumen Freigabe der Aufnahmen missachtet haben. Sie sprechen von schlimmen Raubkopien, weihevollen “Sternstunden” und der “Nachwelt”, die ein Recht habe, jene zu erleben.
Schließlich werden gar die gemeinnützigen Stiftungen des Vaters angeführt, denen der Erlös der Edition zugehe. Damit ist sie perfekt, die moralisch integre, politisch korrekte CD! Ach, welch Ironie der (Schallplatten-) Geschichte: Ausgerechnet der, der sich jeglicher Vermarktung so heftig widersetzte (und sich doch so wunderbar in Szene setzte, gerade indem er sich rar machte und so klug und mit buddhistischem Hintergrund gegen den Kommerz wetterte), gerade der wird nach seinem Tod vermarktet wie kaum ein anderer! Jetzt rächt er sich, der Markt, aber gewaltig. Was soll das scheinheilige mea culpa des Sohnes? Der Vater selbst hat die Mitschnitte der Rundfunkanstalten in München und Stuttgart akzeptiert. Sein Pochen auf die Aura des Konzertes, auf den unverwechselbaren raumzeitlichen Augenblick der Erfüllung, die nicht konserviert werden könne und dürfe, erscheint so doch ziemlich doppelzüngig.
Reichlich geschmacklos ist es hingegen, wenn nun Jünger als Apologeten der Live-Kultur auftreten und per Internet-Chatroom dem Sohn “Leichenfledderei” vorwerfen. Schließlich werden die SWR-Aufnahmen seit zwei Jahrzehnten kontinuierlich gesendet - wer mochte, konnte sich Mitschnitte machen. Nun sind sie käuflich. Nichts spricht gegen ihren Erwerb. Nur das peinliche Beiheft.
Christoph Braun, 01.09.2007
Diese CD können Sie kaufen bei:
Als JPC- und Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen
Kommentare
Für diese Rezension gibt es noch keine Kommentare.






