Startseite · Interview · Gefragt
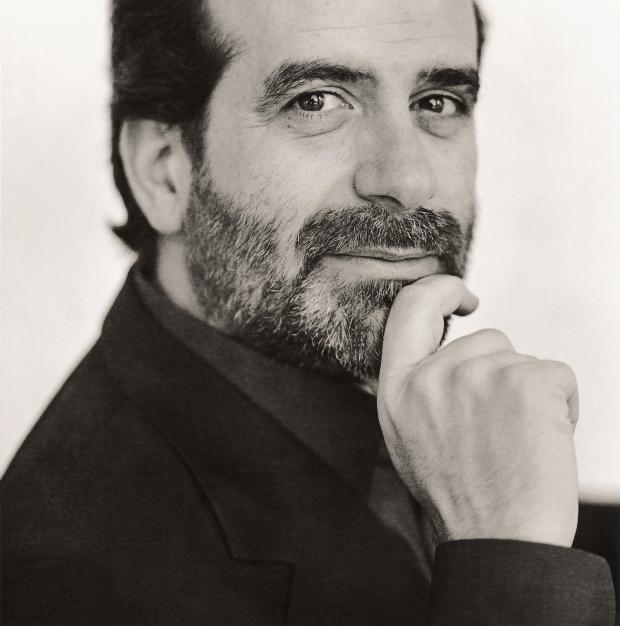
(c) Harald Hoffmann/DG
Andrea Marcon
Die Sterne stehen günstig
Die Planeten finden nicht erst bei Gustav Holst zum Klang. Bereits 1723 brachte Antonio Caldara den Himmel für eine Kaiserin zum Singen.
Auch die Römer, deren Götternamen wir für die Planeten (von griech. Πλανήτης, planētēs, abgeleitet aus dem Verb für „umherschweifen“) bis heute verwenden, orientierten sich an Vorbildern. Bereits die Babylonier waren Weltmeister in Sternenkunde, schieden die wandernden von den fixen Himmelskörpern und identifizierten diese mit ihren Göttern. Dass im Zweistromland Sternbilder und Planeten mit Eigenschaften in Verbindung gebracht und aus ihrer Stellung zueinander Aussagen über Gegenwart und Zukunft abgeleitet wurden, ist der Grundstein jener Astrologie, von der sich auch das Barock magisch angezogen fühlte. Das 17. Jahrhundert mit seinem Faible für Symbole verknüpft den wiedergefundenen antiken Götterhimmel spielerisch zu Allegorien, wenn z.B. der Planet Saturn, das Wesen der Melancholie und das alchimistische Element Blei für ein und dasselbe Prinzip stehen. Doch damit nicht genug: Johannes Kepler greift die pythagoreische Idee der Sphärenmusik wieder auf und versucht, die Idee eines klingenden Planetenreigens als eine Harmonie der Winkel und Maße zu belegen.
Auch über Antonio Caldaras Wiege muss der sprichwörtliche günstige Stern gestanden haben. Der um 1670 geborene Venezianer, der an San Marco sein Handwerkszeug lernt, geht wie ein Komet auf über dem musikalischen Europa. Nach dem Einstieg bei den Gonzaga in Mantua führt ihn sein Weg an den Hof des Fürsten Ruspoli nach Rom (der in Händels Biografie auch eine große Rolle spielt) und weiter an den Kaiserhof nach Wien. Bei Karl VI. ist er im Zentrum des politischen Kosmos angelangt, und der Kaiser liebt Opern. Caldara passt sich dem imperialen Stil an. „Bis 1716 war sein Stil typisch italienisch, leicht und frisch. In Wien hatte aber der Kaiser Opulenz sehr gern. Das spiegelt sich auch in der sehr großzügigen Besetzung der Opern und Oratorien. Caldara sucht dort eher das Majestätische, den großen Klang“, sagt Andrea Marcon, der sich mit dem Vizekapellmeister eingehend beschäftigt hat, genauer gesagt: mit seiner Serenata „La concordia de’pianeti“. 1723 macht die Hofgesellschaft auf der Rückreise von Prag Station in Südmähren. Kaiserin Elisabeth, deren Namenstag am selben Tag begangen wird, ist schwanger, und Wien hofft sehnlichst auf einen Thronfolger. So komponiert Caldara eine gleißende, trompetensatte Festmusik voller Anspielungen auf künftige Mutterfreuden und lässt den ganzen Planetenreigen für sie singen. „Die Besetzung umfasst vier Trompeten, Pauken und natürlich Oboen. Das war für eine Open-Air-Aufführung gedacht“, erläutert Marcon die Besetzung. Für seine Wiederaufführung in Dortmund arbeitete er sich durch eine große Zahl an Mikrofilmen des vergessenen Werks. Ein Spektakel nicht nur für den Adel: Wie das Wiener Diarium vermerkt, war „der Zulauf dermassen häuffig dass die sonst grosse Stadt ihnen fast zu klein worden und die höchsten Dächer besetzet gewesen haben.“ Die Partie des Sonnengottes Apollon sang dabei kein Geringerer als der Kastrat Carestini; für die Aufnahme leiht der argentinische Countertenor Franco Fagioli dem Gott seinen virtuosen, golden funkelnden Alt.
Neu erschienen:
Carsten Hinrichs, 25.10.2014, RONDO Ausgabe 5 / 2014
Das könnte Sie auch interessieren
Pasticcio
Alphatiere unter sich
Sonne – Meer – Sylt. Christian Thielemann hatte sich sicherlich auch nach den Bayreuther […]
zum Artikel
Pasticcio
Ein Brückenbauer
Meldungen und Meinungen der Musikwelt
Im September wird Bochums GMD Steven Sloane im Rahmen der Geburtstagsfeierlichkeiten von Leonard […]
zum Artikel
Hausbesuch
Samos Young Artists Festival
Antiker Stein, gegenwärtig befragt
Der Rahmen für ein Kammermusikfestival in südlichen Gefilden könnte nicht schöner und bequemer […]
zum Artikel





