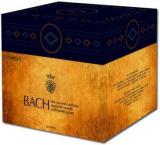Startseite · Interview · Gefragt

(c) Marco Borggreve
Masaaki Suzuki
Himmelskönig, kangei shimasu!
2013 beendete das Bach Collegium Japan die Gesamteinspielung der geistlichen Kantaten Bachs. Nun erscheint das Projekt als opulente Box.
Die meisten waren skeptisch, als sie erstmals von diesem Mammut-Aufnahmeprojekt hörten. Alle geistlichen Kantaten Johann Sebastian Bachs aufzunehmen, das war an sich schon ein Wagnis, das nur wenigen glückte. Nikolaus Harnoncourt und Gustav Leonhardt teilten sich die Arbeit für den ersten Zyklus, Helmuth Rilling schaffte es in einem Anlauf, war bei Abschluss aber künstlerisch schon in die Jahre gekommen. Koopman und Gardiner – beide vollendeten ihren Zyklus 2014 – begannen ihre musikalische „Everest-Besteigung“ bei großen Labels, die in den Krisenjahren auf halber Strecke einen Rückzieher machten. Nur mit Gründung von Eigenlabels waren die Zyklen zu retten.
So viel zu den Vorreitern der Aufführungspraxis in Europa – aber nun ein japanisches Ensemble, das sich gerade einmal 5 Jahre vor Start des Unternehmens zusammengefunden hatte? Doch es genügten wenige Takte, um selbst hartgesottene Skeptiker zu überzeugen: Masaaki Suzuki, Organist seit Kindheitstagen und selbst Meisterschüler Koopmans, ist mit der europäischen Szene bestens vertraut. „Sein Bach“ hatte hier viel gelernt, und konnte die kleinen Eigenheiten und Eitelkeiten der Vorläufer vermeiden. Als Anlass für den Start nahm sich das Bach Collegium Japan den fünfzigjährigen Jahrestag der Kapitulation des Kaiserreiches, in der Überzeugung, dass Bachs Kirchenkantaten in ihrer Vielgestalt ein überkulturelles, zutiefst humanes Kunstwerk sind. Dieser Botschaft galt ihr Projekt – und das schwedische Label BIS schulterte die Produktion.
Klanglich-interpretatorisch lassen die Aufnahmen keine Wünsche offen, soweit man das in solcher Breite betrachtet pauschalieren kann. Suzukis bald schon sehnsüchtig erwarteten Folgen hatten weder regelmäßig solistische Ausfälle wie bei Koopman (und seltener auch Gardiner), noch litten sie unter veralteten Überzeugungen wie Rillings Interpretationen. Auch kannte sein Ensemble kaum Durchlauf, sondern folgte dem leise-bestimmten Dirigenten über ganze 18 Jahre durch einen Kosmos pietistischer Frömmigkeit. Das gilt auch für die Vokalsolisten, unter denen sich so erlauchte Spezialisten finden wie Hana Blažiková, Carolyn Sampson, Robin Blaze, Gerd Türk, oder in fünf Folgen auch der vollmundige wie androgyn schillernde Altus Yoshikazu Mera. Im Continuo ließ Suzuki sowohl Orgel als auch Cembalo zu. Ein Höhepunkt ist jedoch der Chor, mit seiner glasklar prononcierten Aussprache, intonatorischen Präzision und Flexibilität. Wenn man sich denn reiben möchte, ginge das noch am besten an dem überpersönlichen, zuweilen bodenfern schwebenden Klangbild Suzukis. Man muss seiner Ästhetik aber einräumen, dass sie die Leidenschaft des Individuellen ja gerade programmatisch zu überwinden versucht. Kühl ist sein Klangbild nie.
Der Zyklus – für dessen Veröffentlichung als Box nun die ersten 27 Folgen remastered wurden, so dass nun tatsächlich alle 55 Folgen als Hybrid-SACDs das Schwelgen in räumlichem Klang ermöglichen – setzte keinen Schlusspunkt; weltliche Kantaten, Lutherische Messen und Konzerte hat das Bach Collegium inzwischen ebenfalls vorgelegt. Vielleicht wird eine Einspielung des Gesamtwerks daraus? Der Abschluss der Kirchenkantaten aber wurde mit dieser Box schon mal gebührend gefeiert.
Erscheint Anfang April:
Carsten Hinrichs, 02.04.2016, RONDO Ausgabe 2 / 2016
Das könnte Sie auch interessieren
Testgelände
Leonard Bernstein
Mit der Musik per Du
Vor 100 Jahren wurde das Musik-Allround- Genie geboren. Ein Jubiläum, das mit zwei dicken […]
zum Artikel
Pasticcio
Frische Brisen
Es sieht gar nicht so schlecht aus für all die Kultur- und Musikpilgerströme, die sich in diesem […]
zum Artikel
Kronjuwelen
Magazin
Schätze für den Plattenschrank
Obwohl Karl Böhm schon 1981 verstorben war, sorgte er 2015 erneut für Gesprächsstoff. Im Zuge […]
zum Artikel